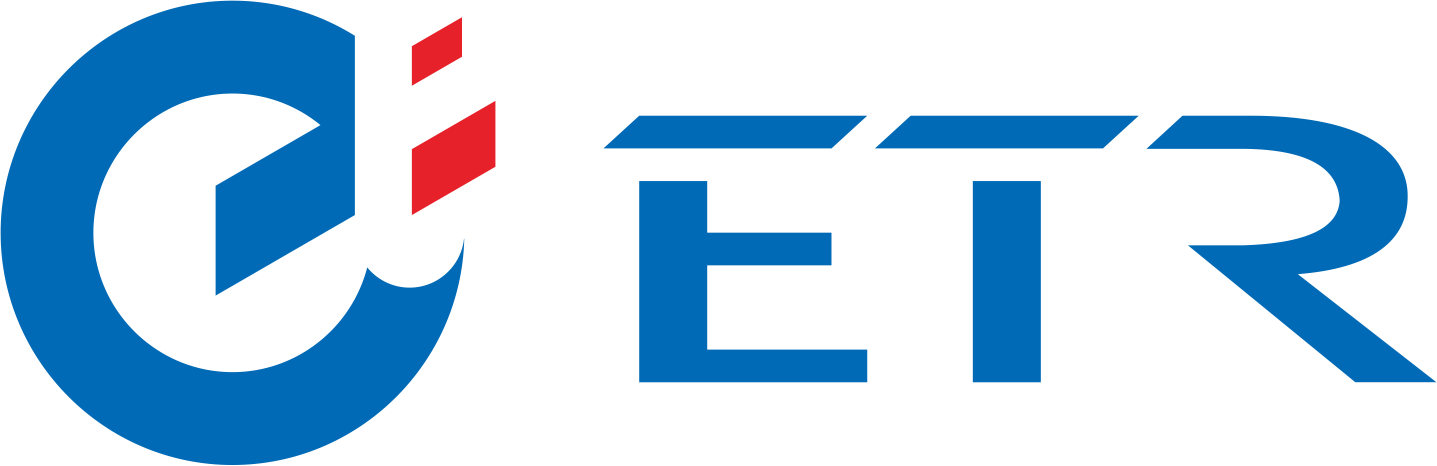Analyse des Prozesses der laminaren Blutfluss-Station
Blut-Laminarflow-Station, auch als sterile Station oder Einweg-Strömungsstation bezeichnet, ist nicht eine einzelne Station oder mehrere Stationen, sondern eine „reine Pflegeeinheit“, deren Kern diese spezielle Station ist und die durch andere notwendige Nebenräume ergänzt wird.
Wir haben in unserer Einrichtung typischerweise mehrere Arten von Patienten. Zunächst gibt es diejenigen, die entweder eine autologe oder allogene Knochenmarktransplantation wegen Leukämie-Behandlungen durchlaufen. Dann haben wir Krebspatienten, die intensive Chemotherapie-Regime hinter sich haben. Patienten mit schweren Verbrennungen benötigen ebenfalls besondere Betreuung, ebenso wie Personen mit schwerwiegenden Lungenerkrankungen und solche, die eine Organspende erhalten haben. Diese Menschen verfügen praktisch nicht mehr über ein funktionierendes Immunsystem, was bedeutet, dass sie sich unbedingt in vollständig sterilen Umgebungen aufhalten müssen, um bloß nicht krank zu werden. Deshalb ist der Bau entsprechender steriler Abteilungen für ihre Überlebenschancen absolut unverzichtbar. Wenn man die aktuellen Praktiken in der Reinraumtechnik betrachtet, bleiben Hämatologie-Abteilungen und Brandverletzten-Zentren die primären Einsatzorte für diese spezialisierten Abteilungen in Krankenhäusern landesweit.
Aseptische Pflege zeichnet sich als eine besondere Pflegeform aus, die in solchen Laminar-Flow-Stationen geleistet wird, bei denen alles darum kreist, eine keimfreie Umgebung zu gewährleisten. Das vorrangige Ziel ist einfach, aber kritisch: Sicherstellen, dass die Patienten in einer vollständig kontaminationsfreien Umgebung behandelt werden. Wenn jemand einen dieser sterilen Bereiche betreten muss, ist damit ein umfangreicher Prozess verbunden. Zuerst kommt das vorgeschriebene medizinische Bad, gefolgt vom Anziehen eines (kompletten Satzes) steriler Kleidung, einschließlich spezieller Hausschuhe, die dafür vorgesehen sind. Nichts wird ohne entsprechende Desinfektion in den Laminar-Flow-Raum gebracht. Sowohl Medikamente als auch persönliche Gegenstände müssen strengen Sterilisationsvorschriften unterzogen werden. Sobald die Patienten sich im Inneren befinden, sind sie stark auf das speziell geschulte Pflegepersonal angewiesen, das alle Aspekte ihrer Behandlung, täglichen Abläufe und allgemeinen Betreuung innerhalb dieses hochgradig kontrollierten Bereichs übernimmt.
1ã€Layout der Blut-Laminar-Flow-Station

Die Wahl des richtigen Standorts spielt für diese Abteilung eine große Rolle. Ideal sollte er klarerweise in Abstand zu nahen Umweltverschmutzungsquellen wie Industriegebieten oder stark befahrenen Straßen liegen. Ebenfalls unerlässlich ist eine ruhige Umgebung ohne ständigen Lärm. Guter Luftaustausch wirkt sich stark auf die Genesungszeiten der Patienten aus. Als bewährte Praxis gilt, diesen Bereich am weitesten Ende des Krankenhauskomplexes unterzubringen. Die Abtrennung von anderen Bereichen der Einrichtung hilft dabei, eine Trennung aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber den Zugang für das Personal zu ermöglichen, wenn erforderlich. Falls mehrere sterile Bereiche innerhalb desselben Gebäudes Platz finden müssen, sollten eigens dafür vorgesehene Wegeverbindungen bestehen, jedoch auch physische Trennungen zwischen den Abschnitten vorhanden sein. Diese Struktur gewährleistet die Hygienestandards über verschiedene Abteilungen hinweg, ohne die notwendigen Interaktionen zwischen medizinischen Teams zu beeinträchtigen, die gemeinsam an der Patientenversorgung arbeiten.
Beim Aufbau von Kapazitäten gibt es keine strengen, festgelegten Regeln. Krankenhäuser entscheiden in der Regel selbst, wie viele Betten sie benötigen, basierend auf dem tatsächlichen Platz in der Abteilung und der jährlichen Auslastung. Für grundlegende Berechnungen gehen die meisten Einrichtungen von etwa 200 Quadratmetern für Abteilungen mit nur ein oder zwei Betten aus. Jedes zusätzliche Bett benötigt in der Regel etwa 50 Quadratmeter zusätzlich zur Basisfläche. Bei Hämatologie-Abteilungen sollte jedoch wirklich mindestens die Einrichtung von vier Laminar-Flow-Zimmern in Betracht gezogen werden. Diese spezialisierten Räume helfen dabei, eine saubere Umgebung aufrechtzuhalten, was besonders bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem von entscheidender Bedeutung ist.
Funktionale Räume jenseits von Laminar-Flow-Stationen benötigen ebenfalls eine angemessene Ausstattung. Die Einrichtung muss wesentliche Supportbereiche umfassen, wie beispielsweise Beobachtungsräume, in denen Pflegekräfte Patienten ohne direkten Kontakt überwachen können. Eine zentrale Pflegestation fungiert als Kommandozentrale für die Arbeitsabläufe des Personals. Saubere Korridore, getrennt von kontaminierten Zonen, sind entscheidend für das Infektionsmanagement. Behandlungsräume erfordern strikte Zonierungsprotokolle. Sterile Lagerbereiche gewährleisten die Sicherheit der Materialien, bis sie benötigt werden. Vorbereitungs- oder Erholungsräume decken die Aktivitäten vor und nach Eingriffen ab. Küchenbereiche für Mahlzeiten gewährleisten die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards. Pufferzonen zwischen unterschiedlichen Kontaminationsstufen helfen, Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Medizinische Bäder bieten spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten. Patiententoiletten müssen barrierefreie Ausstattungsmerkmale aufweisen. Besucherkorridore ermöglichen Angehörigen Zugang, ohne den Klinikbetrieb zu stören. Das Abfallmanagement benötigt eigens dafür vorgesehene Entsorgungsbereiche. Das Personal muss in dafür vorgesehenen Umkleideräumen die Schuhe wechseln, bevor es in sensible Bereiche gelangt. Umkleide- und Duscheinrichtungen stehen sowohl für Patienten als auch für das Personal zur Verfügung. Medizinische Büros und Bereitschaftsräume runden das Angebot ab und stellen eine umfassende Funktionalität aller Abteilungen sicher.
Der Schlüssel zur Infektionskontrolle ist die Trennung von sauberen und verschmutzten Bereichen. Am Eingang zur Pflegeeinheit ist es wichtig, den Fluss von verschiedenen Personen und Gegenständen durch den Raum so zu steuern, dass alle ihren vorgesehenen Wegen folgen und das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert wird. Ein guter Ansatz ist der Bau eines abgedichteten Korridors außerhalb des Hauptstationbereichs. Dieser erfüllt tatsächlich zwei Funktionen: eine für Besucher, die hereinkommen, und eine andere für den Abtransport von Abfallmaterialien. Eine solche Einrichtung gewährleistet die notwendige Trennung zwischen sauberen Zonen und kontaminierten Bereichen, was für die Patientensicherheit in medizinischen Einrichtungen von zentraler Bedeutung bleibt.
Bei der Planung von Laminar-Flow-Zimmern müssen Designer praktische Anforderungen mit Budgetbeschränkungen abwägen. Größere Räume bedeuten umfangreichere Lüftungssysteme, was sowohl die initialen Baukosten als auch die laufenden Betriebskosten erhöht. Patienten verbringen in der Regel etwa zwei Monate in diesen kontrollierten Umgebungen, weshalb räumliche Aspekte im Laufe der Zeit besonders wichtig werden. Es gab Fälle, in denen beengte Verhältnisse zu Gefühlen der Enge bei den Bewohnern führten, was sich in Stimmungsschwankungen von Reizbarkeit bis hin zu offensichtlicher Einsamkeit äußerte. Solche emotionalen Reaktionen können die medizinische Genesung tatsächlich behindern. Praktische Erfahrungen und regelmäßige Beobachtungen in verschiedenen Einrichtungen deuten darauf hin, dass optimale Raummaße innerhalb bestimmter Grenzen liegen. Die meisten Installationen weisen Deckenhöhen zwischen 2,2 m und 2,5 m auf, während die Grundflächen zwischen etwa 6,5 m² und 10 m² variieren, wobei rund 8 m² sich als am angenehmsten für den täglichen Ablauf erwiesen haben. Interessanterweise zeigen neuere Entwicklungen eine allmähliche Verschiebung hin zu etwas größeren Räumen, da medizinische Einrichtungen auf veränderte Vorstellungen von Patientenwohl und Komfort reagieren.
Beim Design von Glasfenstern in Gesundheitseinrichtungen gibt es spezifische Überlegungen für verschiedene Bereiche. Beobachtungsfenster für das Pflegepersonal müssen strategisch zwischen dem Hauptkrankenbereich und entweder dem Eingangsbereich oder dem sauberen Flur platziert werden. Zu Kommunikationszwecken installieren wir zudem Dialogfenster, die den Krankenbereich direkt mit den Fluren für Besucher verbinden. Die Absenkung der Fensterbänke ist wichtig, da dadurch Patienten, die in ihren Betten liegen, sehen können, was sowohl innerhalb der Abteilung, wo Ärzte und Pflegekräfte arbeiten, als auch im Flur, wo Angehörige zu Besuch kommen, vor sich geht. Zudem haben sie so auch eine schöne Aussicht nach draußen. Die meisten Dialogfenster beinhalten solche ausklappbaren oder schließbaren Lamellen aus Aluminiumlegierung, je nachdem, ob gerade Privatsphäre benötigt wird. Unterhalb dieser Pflegefenster befindet sich häufig ein kleines bewegliches Panel oder einfach ein dafür vorgesehenes Loch, speziell zur Durchführung von Infusionsschläuchen. Diese Einrichtung ermöglicht es medizinischem Personal, wesentliche Versorgungsgüter wie Mahlzeiten, Medikamente und Infusionsflüssigkeiten bereitzustellen, ohne die eigentlichen Patientenzimmer betreten zu müssen. Indem die Anzahl der Male, die das Personal eintreten muss, reduziert wird, sinkt das Kontaminationsrisiko und die allgemeinen Hygienestandards der Einrichtung können besser aufrechterhalten werden.
Planung von Durchreichefenstern: Diese speziellen Zugangspunkte funktionieren am besten, wenn sie entlang von Fluren angeordnet sind, die Abteilungen mit Außenbereichen verbinden. So können Mitarbeiter Abfallmaterialien transportieren, ohne andere Bereiche zu kontaminieren. Falls die Gegebenheiten diese Anordnung nicht zulassen, kann der Abfall dennoch direkt an der Quelle verpackt und über dedizierte Durchreichefenster im sauberen Bereich des Korridors weitergeleitet werden. Auch sterile Lagerbereiche benötigen solche Durchreichefenster dringend, ebenso wie Küchen, in denen Lebensmittel zubereitet werden. Die Fenster sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft, während gleichzeitig die erforderlichen Hygienestandards in den verschiedenen Bereichen der Einrichtung gewahrt bleiben.

2ã€Raumgestaltung

Hämatologie-Stationen finden typischerweise entweder Platz innerhalb der Abteilung für innere Medizin oder erhalten manchmal einen komplett eigenen, separaten Bereich. Bei der Einrichtung von Reinräumen müssen diese als eigenständige Bereiche von den übrigen Krankenhauszonen abgegrenzt sein. Innerhalb jedes Reinraums müssen mehrere wesentliche Bereiche vorhanden sein, darunter Vorbereitungsbereiche für das Personal, private Badezimmer mit Duschen und Badewannen für die Patienten, eigene Pflegestationen, spezielle Wasch- und Desinfektionszonen sowie Räume, in denen sich die erforderliche Reinigungstechnik befindet. Aus Gründen des Patientenkomforts und der Infektionskontrolle ist es wichtig, dass die Badezimmer in diesen Reinräumen als separate Einheiten gestaltet werden. Idealweise nimmt jeder Reinraum nur einen Patienten gleichzeitig auf, um die Sterilitätsstandards aufrechtzuerhalten. An jedem Eingang müssen zwei unterschiedliche Schuhwechselbereiche eingerichtet sein, um eine Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Bereichen der Einrichtung zu verhindern. Schließlich sollten in Blut-Laminar-Flow-Stationen die Waschbecken mit berührungslosen Armaturen ausgestattet sein, um die Kontaktflächen zu minimieren und das Infektionsrisiko zu reduzieren.
Für Blutstationen sind während der Behandlungsphasen Reinräume der Klasse I erforderlich, während während der Erholungsphasen Reinräume der Klasse II oder besser akzeptabel sind. Die Luftströmung muss dem Muster mit Aufwärts-Zuluft und Abwärts-Abzug folgen. In Reinräumen der Klasse I insbesondere sollte eine vertikale einströmende Luftströmung die Bereiche abdecken, in denen sich die Patienten bewegen, einschließlich der Betten. Die erforderliche Mindestfläche der Zuluftöffnungen beträgt etwa 6 Quadratmeter, und idealerweise sollte das System seitlichen Abwärts-Abzug umfassen. Falls stattdessen ein horizontal einströmender Luftstrom verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass sich der Patientenbereich stromaufwärts in Strömungsrichtung befindet, mit dem Kopfende des Bettes in der Nähe des Frischluftzutritts. Jedes Zimmer muss über ein Klimasystem verfügen, das zwei separate, parallel arbeitende Ventilatoren enthält, die als redundante Systeme Tag und Nacht ununterbrochen laufen. Ebenfalls unerlässlich sind Geschwindigkeitsregelungen, die mindestens zwei verschiedene Windgeschwindigkeitsstufen ermöglichen. Praktische Richtlinien empfehlen, eine Windgeschwindigkeit von mindestens 0,20 m/s aufrechtzuerhalten, wenn sich Patienten bewegen oder behandelt werden, und während Ruhephasen nicht weniger als 0,12 m/s. Auch das Temperaturmanagement ist von großer Bedeutung. Im Winter sollte die Temperatur nicht unter 22 Grad Celsius fallen, bei einer Luftfeuchtigkeit von über 45 %. In wärmeren Monaten sollte die Temperatur unter 27 Grad Celsius gehalten werden, mit einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60 %. Der Geräuschpegel sollte stets unter 45 Dezibel bleiben, um eine angenehme Umgebung zu gewährleisten. Schließlich ist zu beachten, dass alle angrenzenden und verbundenen Räume einen positiven Druckunterschied von etwa 5 Pascal aufweisen müssen, um Kontaminationsrisiken zu vermeiden.
Bei der Planung eines Klimasystems für Gesundheitseinrichtungen spielen mehrere wichtige Aspekte eine Rolle. Zunächst muss eine angemessene Zonierung basierend auf verschiedenen Faktoren erfolgen, darunter Innenklimaparameter, Anforderungen an medizinische Geräte, Hygienestandards, Arbeitszeiten, Kühlbelastungen und andere spezifische Anforderungen der jeweiligen Bereiche. Funktionsräume benötigen ebenfalls eigene, dedizierte Systeme. Die Zonen müssen so konzipiert werden, dass keine Luftmischung zwischen ihnen stattfindet, um eine Kreuzkontamination in Krankenhäusern zu verhindern. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem Bereichen, bei denen Reinheit besonders wichtig ist, sowie jenen, die mit erheblichen Verschmutzungsproblemen konfrontiert sind – diese sollten definitiv über eigene, isolierte Systeme verfügen. Die richtige Umsetzung macht den entscheidenden Unterschied, um sowohl die Patientensicherheit als auch eine effiziente Betriebsführung aufrechtzuerhalten.
Badezimmer müssen bestimmten Vorgaben entsprechen, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. Bereiche für Patienten benötigen mindestens eine Bodenfläche von 1,10 Metern mal 1,40 Metern, und die Türen müssen nach außen statt nach innen aufschwingen. Infusionshaken sind in diesen Bereichen ebenso unverzichtbar. Bei Sitztoiletten sollten die Toilettensitze kontaminationsresistent sein und eine einfache Reinigung ermöglichen, während bei Stehtoiletten keine Höhenunterschiede an den Einstiegsstellen vorhanden sein dürfen. Sicherheitsgriffe in der Nähe der Toilettenbereiche sind ebenfalls erforderlich. Alle Badezimmer sollten einen kleinen Vorraum sowie automatische Handwaschstationen anstelle von manuell betriebenen Einrichtungen umfassen. Falls Außen-WC-Anlagen geplant sind, ist es aus Sicherheits- und Komfortgründen sinnvoll, diese über Korridore mit den Hauptgebäuden für ambulante Behandlungen oder Stationen zu verbinden. Die Schaffung von geschlechtsneutralen und barrierefreien Toiletten speziell für Patienten wird nach Möglichkeit empfohlen. Sowohl die Planung privater als auch öffentlicher Toiletten muss den Barrierefreiheitsvorgaben entsprechen, wie sie in der aktuellen nationalen Norm "Code for Accessibility Design GB 50763" festgelegt sind.